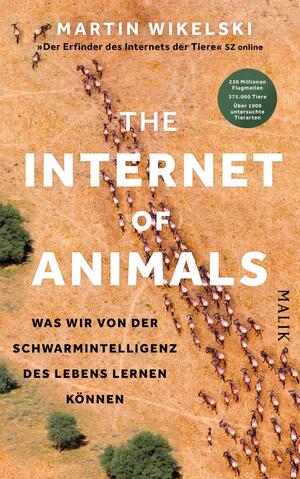
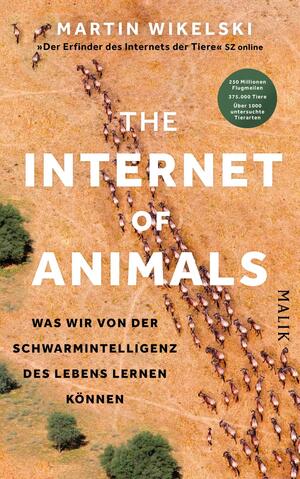
The Internet of Animals: Was wir von der Schwarmintelligenz des Lebens lernen können The Internet of Animals: Was wir von der Schwarmintelligenz des Lebens lernen können - eBook-Ausgabe
„Wikelski schreibt mal mit sachlicher Strenge, mal mit kindlicher Begeisterung.“ - Frankfurter Allgemeine Zeitung
The Internet of Animals: Was wir von der Schwarmintelligenz des Lebens lernen können — Inhalt
250 Millionen Flugmeilen – 375.000 Tiere – über 1000 untersuchte Tierarten
Globale Tierwanderungen sind Martin Wikelskis Leidenschaft. Mit ICARUS, der Observation Tausender von Tieren aus dem Weltraum, eröffnete er eine neue Dimension: Tierbeobachtung als Instrument für den Naturschutz. Packend berichtet er von seiner Vision, dem jahrzehntelangen Engagement und dem endgültigen wissenschaftlichen Durchbruch. Er erklärt, wie Landvögel über Hunderte von Kilometern Ozeane überwinden, ohne Fress- oder Ruhepausen einzulegen. Er folgt Libellen und Füchsen, schildert faszinierende Einblicke und bewegende Erlebnisse mit Bienen, Drosseln und Störchen, Fledermäusen, Seelöwen, Meeresschildkröten, Walhaien und Nashörnern. Und zeigt so, wie wir Menschen von Tieren lernen können, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten.
„Der Erfinder des Internets der Tiere“ Süddeutsche Zeitung
Das Potenzial, das in der natürlichen Intelligenz der Tiere schlummert, ist mindestens so groß wie das der Künstlichen Intelligenz von Maschinen. Dank ICARUS können wir mit dem sechsten Sinn der Tiere
–Artenschutz stärken
–Den Handel mit Wildtieren eindämmen
–Tierwanderungen begreifen
–Naturereignisse besser vorhersagen
–Klimaveränderungen prognostizieren
–Die Verbreitung von Krankheiten kontrollieren
–Das Leben auf der Erde verbessern
Leseprobe zu „The Internet of Animals: Was wir von der Schwarmintelligenz des Lebens lernen können“
Vorwort von Keith Gaddis
Die Planung, Entwicklung und Durchführung bahnbrechender Großprojekte der Wissenschaft erfordert außergewöhnliche Persönlichkeiten. Martin Wikelski ist eine solche außergewöhnliche Persönlichkeit. ICARUS, das Projekt, das er mit viel Geschick über so manche Hürden lenkte, an denen viele andere gescheitert wären, hat eine völlig neue Sichtweise auf unseren Planeten eröffnet.
Gute Wissenschaft, die einen Beitrag zur Lösung der drängenden Weltprobleme leistet, erfordert nicht nur solide Forschung, sondern auch innovatives Denken und [...]
Vorwort von Keith Gaddis
Die Planung, Entwicklung und Durchführung bahnbrechender Großprojekte der Wissenschaft erfordert außergewöhnliche Persönlichkeiten. Martin Wikelski ist eine solche außergewöhnliche Persönlichkeit. ICARUS, das Projekt, das er mit viel Geschick über so manche Hürden lenkte, an denen viele andere gescheitert wären, hat eine völlig neue Sichtweise auf unseren Planeten eröffnet.
Gute Wissenschaft, die einen Beitrag zur Lösung der drängenden Weltprobleme leistet, erfordert nicht nur solide Forschung, sondern auch innovatives Denken und die Entschlossenheit, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Wie entwickeln und verwirklichen Wissenschaftler Ideen, an denen sich noch nie jemand versucht hat? Inwieweit stützen sie sich auf Vorarbeiten anderer, wo schlagen sie neue Wege ein? Wie gehen sie mit Rückschlägen um?
Dieses Buch schildert Martins wissenschaftliche Entdeckungsreise. Seine Liebe zu unserem Planeten und den Tieren ist auf jeder Seite zu spüren. Sein wacher Blick richtet sich auf das große Ganze, das Überleben unseres Planeten durch die Nutzbarmachung der Schwarmintelligenz der Tiere, aber auch auf kleinste Details, beispielsweise darauf, wie man eine rastende Libelle im Baumwipfel aufspürt. Er staunt über die großartigen Migrationszüge kleiner Vögel und darüber, dass es manchmal scheint, als wollten die Tiere den Menschen domestizieren und ihm das Spielen beibringen und nicht umgekehrt.
Ein erfolgreicher Projektleiter zeichnet sich vor allem durch seine Fähigkeit aus, ein gutes Team auf die Beine zu stellen und Unterstützung für sein Vorhaben zu gewinnen. Die Geschichten von Martin in diesem Buch zeigen, dass er in der Feldforschung ebenso zu Hause ist wie in den labyrinthischen Korridoren der Macht. Mal braust er in einem antennenbestückten Wagen kreuz und quer über die Straßen des Mittleren Westens der USA, mal nimmt er an Sitzungen der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos teil, deren „Vorhänge noch den Muff der Sowjetzeit“ verströmen.
Martins Enthusiasmus ist ansteckend, und seine Träume davon, dass sich die Vielfalt des Lebens mithilfe weltraumgestützter Technik ganz neu verstehen lässt, sind unwiderstehlich. Immer hat er die erstaunlichen Fähigkeiten der Tiere im Blick, mit denen er sich beschäftigt, von einem jungen Seelöwen, der auf den Galapagosinseln in seinem Zelt Zuflucht vor einem mächtigen Altbullen sucht, bis zum Storch Hansi, der nicht mit seinen Artgenossen ins Winterquartier zieht, sondern sich von einer bayerischen Familie mit haschierter Leber und warmen Fußbädern über die kalte Jahreszeit bringen lässt.
Ich erfuhr erstmals von Martins Arbeit, als er sich zusammen mit Wissenschaftlern der NASA daranmachte, mittels Satelliten die Möglichkeiten der Beobachtung und Prognose von Tierwanderungen auszubauen. Dank seiner Bemühungen beginnt für uns nun ein Zeitalter, in dem die Migrationsmuster von Tieren auf der ganzen Welt – genauso wie Informationen über Wind- und Meeresströmungen – regelmäßig in kartografische Produkte übersetzt werden. Schon jetzt hat Martins Arbeit zu einem völlig neuen Verständnis der Beziehungen zwischen Naturvorgängen und vom Menschen verursachten Prozessen sowie den Wanderungen, dem Verhalten, der Physiologie und der Gesundheit von Tieren geführt. Noch wichtiger ist jedoch, dass die neuen Wege, die er eröffnet hat, nun für den Schutz bedrohter Arten und Lebensräume auf der ganzen Welt genutzt werden. Seine Vision hat Science-Fiction zum Wohl aller Lebewesen auf der Erde Wirklichkeit werden lassen.
Keith Gaddis, Leiter des Programms für Biodiversität und Öko-Vorhersagen der NASA
PROLOG: Ein Seelöwe namens Baby Caruso
Heute sind die Seelöwen am Strand ziemlich laut. Da muss irgendetwas los sein. Ich sitze unter einem großen Sonnensegel, das von Bambusstangen gestützt wird, unserem Zuhause hier auf der Insel Genovesa, und bereite das Essen für unser vierköpfiges Team zu. Wir leben schon seit etwa fünf Monaten auf dieser ansonsten menschenleeren Insel mitten im Pazifik und beobachten Meerechsen.
Wir möchten etwas über die Körpergröße dieser Tiere auf dem Eiland herausfinden, das zu den Galapagosinseln gehört. Warum sind sie hier so klein, während ihre Verwandten auf der Nachbarinsel Fernandina das rund fünfzehnfache Körpergewicht erreichen? Um das zu erforschen, haben wir unser Lager an einer geschützten Stelle in Strandnähe auf der Westseite der Insel aufgeschlagen. Wir befinden uns zweifellos an einem der schönsten Fleckchen unserer Erde, zugleich auch einem der abgelegensten. Außer uns vieren, die wir mit Sondererlaubnis campen, ist hier keine Menschenseele anzutreffen. Es ist schon ein großes Privileg, sich an einem Ort aufzuhalten, wo die Tiere keine Angst vor dem Menschen kennen, da sie seit Jahrtausenden weder aufgeschreckt noch verfolgt wurden.
Jeden Morgen wachen wir bei Sonnenaufgang auf, kriechen aus unseren Einzelzelten, spazieren zum Strand, um uns zu waschen, bereiten im Schutz unseres gemeinschaftlichen Sonnenzelts Kaffee zu, schnappen uns unsere Ferngläser und Notizhefte und machen uns auf zum Strand, um die Leguane zu beobachten. Viele weitere Tiere leben in unserem Zeltlager und darum herum: Rotfußtölpel, Blaufußtölpel, Fregattvögel, Galapagos-Spottdrosseln, Einsiedlerkrebse und Seelöwen. Die Einsiedlerkrebse haben schon mal das Geschirr vorgesäubert, das ich heute abwaschen soll. Ich sammle die Teller, Töpfe und Becher zusammen, stapele sie in einem Eimer und gehe barfuß über den Sandstrand zum Meer.
Kaum habe ich begonnen, das Geschirr in einer Mulde zu säubern, in der noch etwas Flutwasser steht, da höre ich den Ruf eines Seelöwen, der mir neu ist. Wie alle im Team kann auch ich längst jedes der ungefähr vierzig Tiere an seinem individuellen „Dialekt“ erkennen. Der große Bulle, unser Beachmaster hier, zeichnet sich durch ein tiefes Knurren aus, das seiner Stellung entspricht. Doch was ich nun höre, sind ganz neue, höhere und klarere Töne. Schließlich kann ich sie einem neugeborenen Kalb zuordnen. Die Rufe klingen so schön, dass ich direkt gute Laune bekomme, während ich das Geschirr in der Meerespfütze grob von Schmutz befreie, um es anschließend gründlich in der Brandung abzuspülen.
Doch kaum setze ich mich Richtung Meer in Bewegung, robbt der riesige Beachmaster, der erst vor Kurzem im Kampf mit einem anderen Bullen ein Auge verloren hat, mit erstaunlicher Geschwindigkeit auf mich zu. Ein Klumpen aus Fett und Muskeln, der eine Vierteltonne wiegt, wabbelt in meine Richtung. Hat er mich vielleicht nicht erkannt? Mir bleibt nichts anderes übrig, als mit dem Fuß eine Prise Sand in seine Richtung zu schleudern und ihn energisch anzubrüllen. Zum Glück macht er auf der Stelle halt. Ich bin keine Gefahr für ihn. Vielleicht hat er mich für einen jungen Rivalen gehalten, oder er wollte mir einfach zeigen, wer der Herr an diesem Strand ist – für alle Fälle. Er schaut mich an, brüllt noch ein paarmal, dann ist wieder alles in Ordnung. Er erkennt mich, schließlich sind wir alte Bekannte, wir respektieren einander. Ich mache mich mit dem sauberen Geschirr auf den Rückweg ins Lager und erzähle den anderen von dem neugeborenen Seelöwen mit der schönen Stimme. Wir taufen ihn Baby Caruso.
Drei Jahre später, im Frühjahr 1993, sind wir dabei, unsere Beobachtungen auf der Insel zum Abschluss zu bringen. Es ist eine typische Situation: Rotfußtölpel und Blaufußtölpel spazieren im Lager umher, im Gebüsch hinter uns macht eine Sumpfohreule Jagd auf eine Spottdrossel, die Einsiedlerkrebse sind wie immer mit dem Geschirr beschäftigt. Nach einem ergebnisreichen Observationstag verschwinde ich bei Sonnenuntergang in meinem Zelt, um die Daten in meinen Laptop einzugeben.
Mein Leben im Zeltlager umgibt in diesem Jahr ein Hauch von Luxus: Ich habe einen kleinen Tisch mitgebracht, damit ich mich zur Arbeit in mein Zelt zurückziehen kann, wo mich Wind und Wellen nicht stören. Der Eingang liegt auf der strandabgewandten Seite, sodass mein Laptop einigermaßen gegen die salzhaltige Luft geschützt ist. Ich bin völlig in meine Arbeit versunken, als der Ruf des Beachmasters an mein Ohr dringt. Es ist noch immer derselbe Bulle – jener, der drei Jahre zuvor im Kampf ein Auge verloren hat und der inzwischen offenbar auch etwas schwerhörig geworden ist. Das schließen wir daraus, dass er uns nun immer häufiger nicht zu erkennen scheint, wenn wir unser Geschirr am Strand abwaschen und er auf uns zugeprescht kommt. Erst wenn wir ihn anschreien, wie ich es an jenem Morgen vor drei Jahren getan habe, macht er halt. Und wie damals gibt er sich zufrieden, sobald er merkt, dass er es nur mit uns und nicht mit einem anderen männlichen Seelöwen zu tun hat. Er weiß, dass er nicht ins Lager darf (weil er stinkt, außerdem würde er über unsere Kisten und unser Geschirr hinwegwalzen, vielleicht sogar das Funkgerät, unsere Verbindung zur Außenwelt, kaputt machen).
Außer dem Brüllen des Bullen höre ich jetzt aber auch noch Rufe, die ich vor zweieinhalb Jahren das letzte Mal vernommen habe: die einzigartige Stimme von Baby Caruso. Obwohl sie nun viel tiefer klingt, erkenne ich sie sofort. Ich freue mich riesig, ihn zu hören – und bin auch sehr überrascht. Nachdem er von seiner Mutter nicht mehr gesäugt worden war, hatte er den Strand verlassen. Ich nahm an, er sei umgekommen, da ich ihn seitdem nicht mehr gesehen hatte. Doch nun ist er offenbar wieder zurück am Strand, bringt den Weibchen Ständchen und versucht, den alten Beachmaster herauszufordern.
Der zeigt sich wenig beeindruckt und stürmt auf Baby Caruso zu. Ich höre Sand aufstieben, es kommt zu einem kurzen Kampf, es ertönen das tiefe Grollen des Beachmasters und ein Angstschrei von Caruso, gefolgt vom schwerfälligen Galopp zweier Seelöwen. So bewegen sich diese Tiere nur, wenn sie wirklich Angst haben und eiligst entkommen wollen – oder wenn sie einem verängstigten Gegner nachsetzen. Offensichtlich hat sich das junge Männchen zu nahe an die Weibchen des Beachmasters herangewagt und muss nun schleunigst den Rückzug antreten.
Das Geräusch galoppierender Seelöwen kommt näher. Schon fürchte ich, der Kampf würde vor meinem Zelt ausgetragen. Das könnte gefährlich werden, so wie wenn zwei aufgebrachte Hunde übereinander herfallen und alles um sich herum vergessen. Doch noch ehe ich mich von meinem Tischchen erhoben habe, um mir Klarheit über die Situation zu verschaffen, sehe ich Caruso schon auf meinen Zelteingang zustürmen. Kaum zwei Meter vor mir macht er abrupt halt und schaut mir direkt in die Augen. Dann senkt er den Kopf und gleitet vorsichtig ins Zelt, kriecht unter meinen Tisch und bettet seinen Kopf auf meine Füße. So bleibt er regungslos liegen. Ich höre ihn hecheln, so erschöpft ist er. Und ich bin total verblüfft. Der Beachmaster robbt sich direkt hinter ihm an den Zelteingang heran. Doch er weiß: Hier darf er nicht rein. Ich schreie ihn an. Er erkennt meine Stimme und denkt wahrscheinlich, dass ich gleich Sand nach ihm kicke. Immer noch vor Wut brüllend, tritt er den Rückzug Richtung Strand an. Caruso bleibt bewegungslos unter meinem Tisch liegen.
Ich kann kaum glauben, was ich gerade erlebt habe. Ohne dass ich es ahnen konnte, muss dieses Seelöwenkalb vor drei Jahren mein Verhältnis zum Beachmaster nicht nur beobachtet, sondern vollständig erfasst haben. Caruso hat offenbar bis heute nicht vergessen, dass der Beachmaster nicht ins Lager darf. Irgendwie muss er verstanden haben, dass zwischen dem großen Bullen und mir eine Abmachung besteht: Er ist der Boss am Strand, ich bin der Boss im Lager. Zweieinhalb Jahre war Caruso weg, nun ist er in die Kolonie zurückgekehrt, in der er zur Welt kam. Doch kaum versuchte er, seinen Instinkten folgend, sich den Weibchen zu nähern, bekam er Ärger mit dem alten Beachmaster. Ernsthaft in der Klemme und in Gefahr, Prügel zu beziehen, floh er zu dem einzigen Ort, der, wie er sich erinnerte, für den Beachmaster tabu war: mein Zelt. Caruso hatte eine mentale Verbindung zwischen seiner Seelöwenwelt und meiner Menschenwelt gezogen. Er sah die Schnittstelle zwischen beiden und wusste sie für sich zu nutzen.
Ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, die Verbindung zwischen Mensch und Tier von der menschlichen Seite aus zu verstehen.
KAPITEL 1: Von der Prärie in den Weltraum und zurück
Mitten in der Hochgrasprärie von Illinois im Jahr 1998. Inzwischen habe ich eine Assistenzprofessur an der Fakultät für Ökologie, Ethologie und Evolution der University of Illinois at Urbana-Champaign angenommen. Und da stehe ich jetzt mit einer kleinen Gruppe von Freunden auf einem Feld in der unfassbar weiten, ebenen Landschaft. Der Sommer geht zur Neige, das saftige Grün des beeindruckend hohen Grases verwandelt sich zunehmend in ein sattes Braun. Sein enormes Wachstum verdankt es einer zweieinhalb Meter dicken Schicht des fruchtbarsten Erdreichs unseres Planeten. In früheren Zeiten ist es vorgekommen, dass ein Reiter gegen Ende des Sommers völlig im hohen Präriegras verschwand, wenn er es durchquerte.
Diese Region der Erde ist seit jeher nicht nur ein guter Nährboden für Pflanzen, sondern auch für neue Ideen. Ihre Bewohner sind grundsolide und höchst kreativ zugleich: Tradition ist für sie die notwendige Grundlage von wirklicher Innovation. Nur wer erfolgreich meistert, was er vorfindet, kann etwas vollkommen Neues erfinden. Und so hatte ich an jenem Tag auch ganz besondere Menschen an meiner Seite: Bill Cochran und George Swenson, mittlerweile betagte Männer, die immer noch wie Vater und Sohn miteinander zanken, oder vielleicht eher wie zwei Brüder. Man kann nur staunen, was sie in ihrem Leben alles erlebt haben. Dabei sprechen sie nicht viel über die Vergangenheit. Ihre ganze Sorge gilt der Zukunft und wie es mit der Menschheit weitergeht.
Auf den Tag genau vor einundvierzig Jahren haben sie schon einmal hier inmitten der Hochgrasprärie gestanden. Das war zur Zeit des Kalten Krieges. Die Sowjets hatten gerade den Sputnik-Satelliten in den Weltraum geschossen, die westliche Welt stand unter Schock. Zum ersten Mal war ein Radiosender in den Orbit gebracht worden, der nun seine Kreise um die Erde zog, genauer gesagt, langsam auf unseren Planeten zurückstürzte. Denn das ist das Schicksal von Satelliten auf erdnahen Umlaufbahnen, die über keinen Antrieb verfügen: Auch dort sind sie der Anziehungskraft der Erde ausgesetzt, und selbst in dieser Höhe gibt es noch Schwebeteilchen, die ihren Flug abbremsen, sodass sie langsam spiralförmig zu uns hinabtrudeln. Und während die Welt noch wie gelähmt unter dem Bann dieses Ereignisses stand, hatte George, der ältere der beiden Männer, die man bei aller Unterschiedlichkeit als Seelenverwandte bezeichnen kann, eine Idee: Lass uns einen Empfänger für Sputnik bauen und den Radiowellen, die von dort oben kommen, lauschen. Schließlich ist der Satellit nicht mehr als ein Radiosender, und alles, was man braucht, um seine Wellen zu empfangen, ist ein Funkempfänger.
Bislang hatte George sich mit ganz anderen Radiowellen aus dem Weltraum beschäftigt: jenen, die uns seit Anbeginn der Zeit kontinuierlich von überallher aus dem Universum wie zum Beispiel von fernen Galaxien erreichen. Dem Weltraum zuzuhören ist wie einem Konzert zu lauschen. Die Musik seiner Sterne unterscheidet sich nicht wesentlich von einer Verdi-Oper. Die Wellen, die beide aussenden, haben zwar etwas andere Frequenzen, aber beide liefern uns schöne Klänge. Wir müssen uns nur darauf einstimmen. Genau das hatte George sein Leben lang getan, für ihn war das Universum, also alles, was uns umgibt, eine Symphonie von Wellen. Das hatte ihn zur Beschäftigung mit Musik, dem Knall von Schusswaffen und der Radioastronomie geführt – und die einzigartige Gelegenheit, die ihm Sputnik praktisch vor seiner Haustür bot, wollte er sich natürlich nicht entgehen lassen.
Der Sputnik-Satellit war seine Chance, sich einen Namen in der Welt der Wissenschaft zu machen. Alles, was er dazu benötigte, war ein Gerät, um dessen Funkwellen zu empfangen. Dafür wandte er sich an Bill, seinen jüngeren Seelenverwandten. Bill war im Grunde seines Herzens ein Freigeist, der stets seinen Eingebungen folgte, und in den Augen von George „der einfallsreichste Kopf, der mir je begegnet ist“. So beschrieb er ihn noch Jahrzehnte später, mit fünfundneunzig Jahren, wenige Wochen vor seinem Tod im Jahr 2017. Ruhm reizte Bill nicht, für ihn war es einfach ein spannendes Abenteuer, den ersten Satelliten im Weltraum zu belauschen.
Bill ging also in den Keller hinunter und begann, an einem Empfänger zu basteln, wie er es von seinem Vater, der Radioamateur war, gelernt hatte. Das war eine gewisse Herausforderung, denn der Radiosender nutzte eine besonders schwer zu empfangende Frequenz. Doch nach sechsunddreißig Stunden ununterbrochener Arbeit hatte Bill seinen Sputnik-Empfänger. Sofort informierte er George, und sie fuhren hinaus in die Prärie und warteten darauf, dass Sputnik über den Horizont kam. So zuverlässig, wie es die Physik des Orbitalflugs voraussagte, erschien der künstliche Erdtrabant am Himmel, und Bill und George, die 1957 an genau dieser Stelle standen, hörten die ersten vom Menschen erzeugten Geräusche aus dem Kosmos.
Das allein war schon bemerkenswert, aber die beiden Forscher hielten sich nicht lange damit auf, dass es ihnen gerade gelungen war, Sputnik zu belauschen, sondern richteten den Blick sogleich in die Zukunft. Hitzig diskutierten sie, was sich mit diesem Wissen anfangen ließe. Nahezu gleichzeitig kam ihnen dieselbe Idee. Ihr Gedankengang sah in etwa wie folgt aus: Zuerst benutzen wir diese Signale, um die genaue Umlaufbahn von Sputnik zu bestimmen, und dann analysieren wir sie gezielt auf Verzerrungen. Wenn sich zwischen Sputnik und uns nichts als leerer Raum befände, müsste das Signal so perfekt bei uns ankommen wie der Kammerton A einer Stimmgabel. Doch dazwischen liegt die Erdatmosphäre, die sich fortlaufend verändert, und dann ist da noch das Weltraumwetter darüber und unser Wetter hier unten. Halten wir die Bedingungen auf der Erde allerdings konstant, vergleichen also nur Empfangssignale bei ähnlichen Wetterbedingungen miteinander, dann kann die Verzerrung im Piepen von Sputnik uns Informationen über die Veränderungen in der Zusammensetzung der höheren Atmosphäre liefern. Was für ein aufregender Gedanke! Allein eine verzerrte Welle – ein leicht merkwürdiger, zitternder Kammerton A – könnte uns Informationen über die dynamischen Muster im Universum liefern. Wir brauchen nur genau hinzuhören. Exakt dieses Prinzip nutzten Bill, George und ich Jahre später, um Tieren und der von ihnen produzierten Symphonie von Wellen zu lauschen.
Innerhalb von zwei Wochen hatten Bill und George genügend Daten gesammelt, um die genaue Umlaufbahn des Sputnik-Satelliten zu veröffentlichen und anschließend die Zusammensetzung der oberen Atmosphäre zu diskutieren. Doch als ich mit diesen beiden großartigen und doch so bescheidenen Pionieren auf dem besagten Feld in jener topfebenen Weltgegend stand, war ein anderer Aspekt ihrer Arbeit für mich viel wichtiger. Wieder einmal ging es um die Zukunft, nicht um die Vergangenheit. Während George einundvierzig Jahre zuvor eine großartige Laufbahn als Radioastronom begonnen hatte, war Bill zum Begründer des Forschungsgebiets der Biotelemetrie geworden. Nun liefen ihre beiden Karrierewege wieder zusammen.
Die Radioastronomie nimmt, häufig auf der Suche nach dem Anbeginn der Zeit, das Außen in den Blick, den Raum vom Planeten Erde bis zum Rand des Universums. Im Unterschied dazu richtet die Biotelemetrie den Blick nach innen, darauf, was hier und heute auf unserem Planeten geschieht. Dazu stattet sie Tiere mit einem Gerät aus, das deren Vitaldaten und Aufenthaltsorte aufzeichnet und dann an einen Empfänger zurücksendet. Das Biologging verfolgt einen ähnlichen Ansatz, aber hier muss das am Tier befestigte Gerät erst wieder geborgen werden, um die gesammelten Daten herunterzuladen und auszuwerten. Biologging und Biotelemetrie schicken Tiere quasi mit einem Tagebuch durch die Welt, wie es mein Freund Rory Wilson ausdrückt, einer der Pioniere dieser Idee. Das Ziel dabei ist die Visualisierung des Unsichtbaren. Was machen Tiere, wenn sie niemand beobachtet? Und was können wir von den Interaktionen all dieser Tiere lernen, den intelligentesten Sensoren, die man sich überhaupt vorstellen kann?
Viele Feldbiologen bemühen sich heute darum, völlig neues Wissen zu erschließen. Unsere Herangehensweise an das Leben und an die Biologie, also die Wissenschaft vom Leben, unterliegt derzeit einem fundamentalen Wandel. Uns interessieren weniger die offensichtlichen Dinge, die wir mit unseren eigenen Augen oder Ferngläsern und Mikroskopen beobachten können. Biologen wollen heute vielmehr den großen Schatz an unsichtbarem Wissen heben, den die Tiere besitzen und der sich nur zutage befördern lässt, wenn wir ihr Zusammenspiel untereinander und mit ihrer Umgebung verstehen. Man könnte es die Suche nach dem sechsten Sinn der Tiere nennen, die Visualisierung des Unsichtbaren. Das ist ein großes Unterfangen, vergleichbar mit der Suche nach den Gravitationswellen, dem „Gottesteilchen“ (dem Higgs-Boson) oder dem Anfang der Zeit. Nichts davon werden wir je mit eigenen Augen sehen – dazu sind wir einfach nicht geschaffen –, aber wir haben mit unserem Wissen ein Stadium erreicht, in dem wir sowohl in der Biologie (Bills Arbeitsgebiet) als auch der Radioastronomie (in der George brilliert) absolutes Neuland betreten können. Während die Suche nach dem Unsichtbaren zum Tagesgeschäft der Radioastronomie gehört und schon in ihren Anfängen mit der dunklen Materie und den Gravitationswellen zu bahnbrechenden Entdeckungen führte, wird in der Biologie mit großer Spannung erwartet, wohin uns dieser Weg führen wird.
Damals, auf dem Feld in Illinois, erklärte mir George, dass nach seinem Dafürhalten die Radioastronomie ihre glorreichen Tage bereits hinter sich hatte. Anfangs sei sie ein aufstrebendes Forschungsgebiet wie viele andere gewesen, auf dem einzelne Universitäten und Institute ihre eigenen Projekte verfolgten, ohne viel mit anderen zusammenzuarbeiten. So hatten sie alle ihre eigenen Teleskope. Alle erzielten damit gute Ergebnisse, doch gemeinsam genutzte, aufeinander abgestimmte Beobachtungsgeräte – wie es sie heute dank George gibt – stellen viel mächtigere Werkzeuge dar. Wir wissen das vom Facettenauge der Insekten. Nimmt man nur ein Ommatidium, wie die Einzelaugen heißen, die man mit einem Miniteleskop vergleichen kann, dann sieht man damit ziemlich wenig. Setzt man aber Tausende von ihnen zu einem Instrument zusammen, ermöglichen sie den Blick auf unglaubliche Details. Die Kopplung von Teleskopen war ein Quantensprung in der Beobachtung des Universums.
Und dafür hatte George gesorgt. Er leitete das technische Planungsteam für das Very Large Array (VLA) in der Ebene von San Augustin, achtzig Kilometer westlich von Socorro im US-Bundesstaat New Mexico, das 1980 als weltweit erstes Teleskopfeld den Betrieb aufnahm. Das VLA setzt sich aus vielen einzelnen Teleskopen zusammen, die in enger Abstimmung ein Bild des Universums erstellen. Es hat die Menschheit einen großen Schritt vorangebracht, denn trotz aller internationaler Probleme entstand auf diese Weise eine Kooperation zwischen Ländern zur Beobachtung des Weltalls. Und George, den Blick immer auf die Zukunft gerichtet, hatte noch weitere Ideen, wie man das VLA nutzen könnte.
Die Frage nach Außerirdischen erregte damals die Gemüter. George war Mitglied eines Forschungskomitees, das sich mit der Suche nach Hinweisen auf deren Existenz beschäftigte, und kam nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss, dass man den Datenschatz, den die Beobachtung des Universums lieferte, auch nach Anzeichen dafür durchforsten konnte, ob es irgendwo da draußen intelligentes Leben gibt. Und so schlug er vor, in die Arbeit des VLA ganz nebenbei auch die Suche nach extraterrestrischer Intelligenz einzubeziehen. George machte mir immer wieder eindrücklich klar, dass die Entdeckung von Anzeichen intelligenten Lebens im Weltraum das Bild, das wir von uns selbst, unserer Bedeutung und unserem Platz im Universum haben, vollkommen verändern würde. Dabei spielte es für ihn keine Rolle, ob man zu dieser Erkenntnis in zwei, zwanzig oder in zweihundert Jahren gelangen würde. Der geringe Aufwand, den es erforderte, die wunderbare Symphonie der Radiowellen, die uns aus dem Universum erreichen, auch nach Anzeichen für außerirdische Intelligenz zu durchkämmen, war für ihn angesichts der einschneidenden Bedeutung einer solchen Entdeckung die Sache auf jeden Fall wert.
Doch Bill hatte getreu seiner Rolle des jüngeren, willensstarken Bruders so seine eigenen Ideen. Seiner Meinung nach ließ sich die Technologie, die er mit George zum Abhören von Sputnik entwickelt hatte, noch weit vielversprechender und spannender zum besseren Verständnis des Lebens auf der Erde als zur Suche nach Leben auf fernen Planeten einsetzen. Einige Jahre vor seinem Tod gab George ihm schließlich recht. Wenn er noch einmal von vorn anfangen könnte, sagte er mir, würde er sich mit Bill den Biologen und Ökologen anschließen, um das Leben auf der Erde zu erforschen. Das neue Feld der globalen Ökologie habe alles, was auch die Radioastronomie vierzig Jahre lang ausgezeichnet hatte: Es biete spannendes, vielversprechendes Neuland mit großem Potenzial für weitere Entdeckungen im Universum des Lebens, nur eben im Universum direkt vor unserer Haustür und auf unserem eigenen Planeten.
Was aber tat nun Bill, nachdem er Sputnik belauscht hatte? Ganz einfach: Er konstruierte einen kleinen, Sputnik ähnlichen Radiosender und befestigte ihn erst an einer Ente und später an einem Kaninchen. Dazu benutzte er einen Empfänger ähnlich jenem, den er zum Belauschen von Sputnik verwendet hatte. Doch während der Satellit seine Signale mit Unterbrechungen gesendet hatte, baute Bill einen kontinuierlich funkenden Sender, sodass er permanent Informationen von seinen Tieren erhalten konnte. Auch jetzt horchte er wieder auf Verzerrungen im Funksignal, nur dass diese Schwankungen der Wellenform nicht eine Veränderung in der Zusammensetzung der Atmosphäre anzeigten, sondern eine Veränderung der Atemfrequenz der Ente, die er nach der Besenderung wieder freigelassen hatte.
Ganz ähnlich machte es Bill mit dem Baumwollschwanzkaninchen, dem er zusammen mit seinen Kollegen vom Illinois Natural History Survey viel länger folgte als der Ente. Es war erstaunlich, was sie auf diese Weise über ein Tier erfuhren, das sie gut zu kennen glaubten, von dem sie aber offensichtlich vieles gar nicht wussten – denn dieses kleine Kaninchen verhielt sich vollkommen anders als erwartet, sobald es außer Sichtweite der Biologen war. Die Funkwellen seines Senders gaben ihm eine Stimme, mit der es ihnen etwas über seinen Aufenthaltsort, seine Gewohnheiten, seine Ängste und seine Vergnügungen mitteilen konnte.
Die Wege der beiden Männer, die so viel miteinander teilten und doch so verschieden waren, konnten kaum unterschiedlicher verlaufen. George wandte sich dem Universum zu und kehrte schließlich zur Biologie zurück, weil sie einfach schöner ist. Und Bill ließ sich von den Tiefen des Weltalls dazu inspirieren, mehr über die Kreaturen auf dem Planeten Erde herauszufinden, um schließlich zu verstehen, wie alles Leben miteinander zusammenhängt. Um diese Zusammenhänge geht es auch in diesem Buch. Es handelt davon, was uns mit den Weiten des Weltalls verbindet, und von unserer Neigung, den Blick in die Ferne schweifen zu lassen, anstatt ihn auf den schönsten Ort im Universum zu richten, unseren Planeten – wobei uns meist nicht klar ist, welchen Schatz wir mit ihm besitzen, weil er so offen vor unseren Augen liegt.
„Wikelski erzählt in ›The Internet of Animals‹ packend von seinen Forschungsreisen und schildert faszinierende Erlebnisse mit allerlei Tieren.“
„Überaus lebendig und anschaulich“
„Wikelski schreibt mal mit sachlicher Strenge, mal mit kindlicher Begeisterung.“
„Auf 318 Seiten gibt er faszinierende Einblicke in die sensorischen Fähigkeiten und das Gruppenverhalten von Wildvögeln, Seelöwen, Füchsen und Giraffen – und in die Arbeit an seinem Lebenswerk, dem Tierbeobachtungsprojekt Icarus.“
„Ein Sachbuch, spannend wie ein Thriller.“
„Man kann ganz tief eintauchen in ein wirklich wunderbar geschriebenes Buch.“
„Der lange Weg von der Idee zur Verwirklichung liest sich wie ein technischer Krimi. Doch Wikelski streut auch amüsante wie informative Kapitel aus seinen Forschungen auf der Erde ein.“
„Lebendig und mit überraschenden Details schildert Martin Wikelski Begegnungen mit Menschen und Tieren.“


















DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.